Mein CD Spieler hat einen digitalen AES/EBU Ausgang, der hat aber keinen Software EQ für Dynamik Korrektur. Und meine digitale Netzwerk Vorstufe hat keinen digitalen Ausgang. Damit kann ich Lautsprecher wie die Dynaudio Confidence 20A nicht "direkt" anschließen Hier ein Consumer Bericht mit Piega Lautsprecher als Referenz in der Premium Klasse.
Die COAX Passive Reihe ist erfolgreich. Ich wünsche dem Piega Team, dass sie nicht den Focus verlieren.
Hier ein interessantes Youtube ab Minute 17, wie Störungen, z.b. Vibrationen, sich negative auf analoge Musik Informationen im Lautsprecher auswirken können.
Die COAX Passive Reihe ist erfolgreich. Ich wünsche dem Piega Team, dass sie nicht den Focus verlieren.
Hier ein interessantes Youtube ab Minute 17, wie Störungen, z.b. Vibrationen, sich negative auf analoge Musik Informationen im Lautsprecher auswirken können.

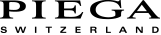



Kommentar