Basierend auf dem Strangpressprofil der Coax 611 wurde ein Bändchen-Horn-System aufgebaut - also zumindest im Hochtonbereich. Bass- und Mittelton sind „gewöhnlich“ konzipiert. Der grundsätzliche Gehäuseaufbau entspricht dem der Coax 611. Das heißt, die Längsversteifung des Profils und die Bitumendämmung sind identisch mit der 611. Ohne Ausreden und Geschwurbel: Die TIM waren für die Premium zu teuer. Daher kommt eine Holzmatrix zur weiteren Gehäuseversteifung zum Einsatz. Folgerichtig ist das Gehäuse der 801 nicht „vorgespannt“.
Die Basschassis sind bereits aus der Premium Gen2-Baureihe bekannt. Allerdings kommen 4 (angetriebene) Chassis in einem BR-Gehäuse (BR-Rohre auf der Rückseite) zum Einsatz. Im Endergebnis sind Theorie und Messschriebe dabei im Einklang. Der doppelte Chassis-Einsatz gegenüber der 701 bedeutet eine Verdoppelung des Schalldrucks (= +6dB) im Arbeitsbereich der Tieftöner.
Der einzelne Mitteltöner arbeitet in einem eigenen geschlossen Gehäuse. Auch er basiert auf dem bekannten Chassis aus der aktuellen Premium-Reihe. Die untere Trennfrequenz wurde etwas angehoben, um den Treiber zu entlasten und die Intermodulationen bei höherem Pegel zu reduzieren.
Selbstverständlich wurde auch die Frequenzweiche neu entwickelt. Hier stand auch eine möglichst hohe „Verstärkerfreundlichkeit“ auf dem Zettel. Das bedeutet: keine komplexe Last für den Amp. Der Impedanzverlauf ist unkritisch, somit sind keine Verstärkerprobleme zu erwarten. In Kombination mit der Impedanzlinearisierung ist das Bedarfsprofil (die Minimal-Anforderung) für den Amp sehr niedrig.
Aber jetzt, das neue „Herzstück“.
Selbstredend kommt der im letzten Jahr vorgestellte Tweeter RM 01-24 zum Einsatz. Dieser ist auf Grund seines Aufbaus hochgradig flexibel, was den Einsatzzweck angeht. Und so entwickelte und simulierte das PIEGA-Team in mehreren Stufen die Anwendung als Horn-Tweeter.
Hornlautsprecher sind von einem Nimbus umgeben: groß, laut, Profibeschallung. Und wie so oft gilt: Es gibt Vor- und Nachteile. Gleich vorweg, der Punkt „groß“ ist relativ. Da es hier nur um den Hochtonbereich geht, sind auch die Dimensionen des Hornvorsatzes Hifi- und wohnraumkompatibel.
Worum geht’s beim Horn?
Hornlautsprecher zeichnen sich dadurch aus, dass sie extrem laut können. Das hängt damit zusammen, dass der Schall im „trichterförmigen“ Horn gebündelt und gerichtet abgestrahlt wird. Der entscheidende Faktor ist dabei, dass bei einem “normalen“ Chassis die Luft seitlich „ausweichen“ kann, es wird somit weniger Luft vor der Membran komprimiert, somit weniger Schall“druck“ erreicht. Das Horn verhindert das seitliche Ausweichen der Luft. Der Techniker spricht in dem Zusammenhang von einer akustischen (Impedanz-)Transformierung. Mit Ironie: Es ist ein „akustischer Trafo“. Zusätzlich wird der Schall von der Membran durch den „Hals“ des Horns über die sog. „Mundöffnung“ abgestrahlt. In der Theorie entspricht die Mundöffnung einer gleichgroßen Membran. Insgesamt wird die Membran also besser an die Luft angekoppelt – der Wirkungsgrad des Systems (Treiber und Hornvorsatz) steigt an.
Im Ergebnis sind wesentlich kleinere Membranbewegungen für den gleichen Pegel erforderlich als bei einem Chassis ohne Hornvorsatz.
Wie wir wissen, sind kleine Membranbewegungen vorteilhaft, da Verzerrungen durch Klirr und Intermodulationen niedrig bleiben. Kurz: Kleine Membranbewegungen erzeugen auch nur kleine Verfälschungen. Mit kleinsten Membranbewegungen werden in Kombination mit dem Hornvorsatz hohe Pegel möglich, die auch kaum Leistung einfordern. Somit können überragende Ergebnisse im Bereich der Dynamik mit sehr niedrigen Verzerrungen erreicht werden. Hier spielt das Horn seinen größten Trumpf aus.
Da der Mittel- und die Tieftöner nicht so laut können wie das Horn, wird das Horn in der Weiche „runtergeregelt“. In der Folge sind die Membranbewegungen sehr „sparsam“ und somit werden Verzerrungswerte erreicht, die um „die Nulllage pendeln“.
Das Horn hat eine gewisse Baulänge zwischen Mund- und der Halsöffnung, an der der Tweeter befestigt ist. Dadurch „rutscht“ das Hochton-Chassis weiter nach „hinten“ oder genauer nach „innen“. Das ist gut, denn somit befindet sich das akustische Zentrum des Tweeters ungefähr auf einer Ebene mit dem akustischen Zentrum des Mitteltöners. Das akustische Zentrum eines Chassis ist in etwa dort, wo die Schwingspule mit der Membran verklebt ist. Je enger diese Zentren mehrerer Chassis zusammenliegen, desto geringer sind die Laufzeitdifferenzen des Musiksignals auf dem Weg zum Ohr. Die umgangssprachliche Zeitrichtigkeit verbessert sich, was der Ortung und Abbildung zu Gute kommt.
Randnotiz: Genau das ist ja der große Vorteil des PIEGA Coax-Chassis. Dort liegen die akustischen Zentren des Mittel- und des Hochtöners nicht nur auf einer Ebene, sondern auf einem Punkt.
Der Hornvorsatz verbessert den Wirkungsgrad, das hatten wir schon. Aber da sich der Wirkungsgrad auch im unteren Frequenzbereich des Tweeters erhöht, kann er tiefer angekoppelt werden. Während der baugleiche Tweeter in der 701 so bei ~3,5 kHz angekoppelt wird, fängt er in der 801 bereits ab ~2,7 kHz an zu arbeiten. Große Teile des Präsenzbereiches werden somit von der leichten Folie übertragen.
Denn wie die Stammleute im PIEGA-Forum wissen, fangen LS-Chassis ab bestimmten Frequenzen an zu bündeln. Irgendwo um 3 kHz liegt die Grenze beim Mitteltöner. Eine „Auswirkung“ der Bündelung ist eine Abweichung im Amplitudengang, vor allem in der seitlichen Hauptachse. Da der Tweeter bereits ab ~2,7 kHz seine Arbeit aufnimmt, kommt der Mitteltöner nicht in die „Gefahrenzone“. Es entsteht ein nahtloser Übergang zwischen Mittel- und Hochtöner, wodurch sich ein sehr ausgewogenes und homogenes Klangbild „in der Breite“ ergibt.
Gibt’s denn keine Nachteile, abgesehen von der Baugröße?
Durchläuft der Schall eine wie auch immer gestaltete Schallführung, entstehen an den Begrenzungsflächen stehende Wellen. Durch Ungleichmäßigkeiten im Abstrahlverhalten der Membran (Bündelungsverhalten) und den Näherungswerten in der Berechnung des Horns kann es in Summe zu Abweichungen im Amplitudengang kommen. Da aber die Ursachen und Auswirkungen bekannt sind, lässt sich das insbesondere über die Horngeometrie kompensieren.
Die Richtwirkung könnte im HiFi-Bereich ebenfalls ein Thema werden. Hier kann aber auch absichtlich ein gezieltes Abstrahlen erreicht werden, um z. B. die Akustik-Einflüsse von Boden/Decke zu reduzieren. Je nach Hornkonzeption, Einsatzzweck und Hörumfeld kann das also einen Vor- oder Nachteil bedeuten. PIEGA setzt eine Horn-Geometrie ein, die eine sehr gleichmäßige Horizontalabstrahlung ermöglicht, was eine recht gleichmäßige Energieabgabe in den heimischen Hörraum ergibt. In der Folge ist der Amplitudengang auch außerhalb der Achse noch recht gleichmäßig.
Ganz klar, viele ältere und einfachere Hornkonstruktionen haben das Prinzip in Verruf gebracht. Das Wissen um Hornkonstruktionen ist allerdings ständig gewachsen und die Zeiten, dass Hörner verfärben (die berühmt-berüchtigte „Trötneigung“) sind lange vorbei. Auch, dass an den Hornrändern Resonanzen entstehen könnten, ist in der Ursache mittlerweile bekannt und kann in der Ausformung/Materialwahl berücksichtigt werden. Allerdings stecken die damals gravierenden Nachteile noch irgendwie in den Köpfen. Insgesamt gesehen sind ein paar Nachteile zwar immer noch vorhanden, aber bei weitem nicht mehr in den Größenordnungen, wie vor 50 oder 60 Jahren. Überwiegen also die Vorteile so stark, dass die Nachteile in Kauf genommen werden können?
Soweit die ganze Theorie.
Lassen wir den Tieftonbereich (größenbedingt) mal außen vor, könnte das Horn also ein durchaus probates Mittel auch für den Heim-HiFi-LS werden. Insofern war ich natürlich sehr gespannt, wie das Ganze funktioniert, zumal die Kombination Horn und Folientreiber im HiFi-Bereich eher selten ist.
Bevor gehört wurde, durfte ich Roger bei der Abstimmung über die Schulter sehen. Für dieses Feintuning wurde die „Messe-Version“ als Vergleich genommen, die einige von euch vielleicht auf der HighEnd in München (2025) hören konnten. Das Feintuning für die Serie erfolgte an einer „weichenlosen“ 801-Variante. Wie das im Prinzip genau abläuft, könnt ihr hier nachlesen.
Für meine Ohren war die Messe-Variante im Mittel-Hochtonbereich nicht ganz perfekt ausgewogen. Roger demonstrierte, wie sich die einzelnen Weichenparameter auswirken und sich dabei der Charakter des LS veränderte. In der endgültigen Abstimmung ergab sich eine perfekte Balance zwischen dem Mittel- und Hochtöner, gleichzeitig wurde der Bass optimiert. In dieser Abstimmung wird die Weiche für die Serie gebaut. Die nachfolgenden Vergleiche beziehen sich natürlich auf diese Variante.
Die meisten Hörvergleiche erfolgten im „vernünftigen HiFi-Pegel“ (irgendwo um 75 dB am Hörplatz bei ca. 3 Meter Abstand). Aber auch recht leise wurde gehört, und natürlich haben wir gelegentlich auch „den Bären steppen lassen“. Die Bandbreite der Musikauswahl bestand aus ruhigen Aufnahmen mit A Capella-Stimmenaufnahmen im kleinen Studio, über Rock-Konzert und Blueskeller bis zum Live-Auftritt eines Swing-Orchesters und ihren Bläser-Attacken.
Die Streaming-Musik spielte über Rogers Notebook, welches auch die Weiche für die 801 generierte. Das Signal ging vom Notebook über ein RME-Interface in die prof. Mehrkanal-Endstufe, die die 2 x 3 Wege der 801 antrieb. Streng genommen ist die gehörte 801 demnach ein Aktiv-LS, der aber in seiner Abstimmung 100%ig identisch mit der späteren Serienversion ist. Die prof. Mehrkanalendstufe befeuerte GLEICHZEITIG zusätzlich die 701 und die Coax 611. Somit gilt: ALLE Lautsprecher und jedes einzelne Chassis der 801 wurden über baugleiche Verstärker betrieben!
Wir hörten die Premium 701, die 801 und die 611 im direkten Vergleich ohne umstecken und mit identischem Pegel. Ganz klar, das ist ein Vergleich, den man in dieser Form beim Händler wahrscheinlich nicht durchführen kann.
Vielen Dank an Roger für seine Unterstützung
Die Basschassis sind bereits aus der Premium Gen2-Baureihe bekannt. Allerdings kommen 4 (angetriebene) Chassis in einem BR-Gehäuse (BR-Rohre auf der Rückseite) zum Einsatz. Im Endergebnis sind Theorie und Messschriebe dabei im Einklang. Der doppelte Chassis-Einsatz gegenüber der 701 bedeutet eine Verdoppelung des Schalldrucks (= +6dB) im Arbeitsbereich der Tieftöner.
Der einzelne Mitteltöner arbeitet in einem eigenen geschlossen Gehäuse. Auch er basiert auf dem bekannten Chassis aus der aktuellen Premium-Reihe. Die untere Trennfrequenz wurde etwas angehoben, um den Treiber zu entlasten und die Intermodulationen bei höherem Pegel zu reduzieren.
Selbstverständlich wurde auch die Frequenzweiche neu entwickelt. Hier stand auch eine möglichst hohe „Verstärkerfreundlichkeit“ auf dem Zettel. Das bedeutet: keine komplexe Last für den Amp. Der Impedanzverlauf ist unkritisch, somit sind keine Verstärkerprobleme zu erwarten. In Kombination mit der Impedanzlinearisierung ist das Bedarfsprofil (die Minimal-Anforderung) für den Amp sehr niedrig.
Aber jetzt, das neue „Herzstück“.
Selbstredend kommt der im letzten Jahr vorgestellte Tweeter RM 01-24 zum Einsatz. Dieser ist auf Grund seines Aufbaus hochgradig flexibel, was den Einsatzzweck angeht. Und so entwickelte und simulierte das PIEGA-Team in mehreren Stufen die Anwendung als Horn-Tweeter.
Hornlautsprecher sind von einem Nimbus umgeben: groß, laut, Profibeschallung. Und wie so oft gilt: Es gibt Vor- und Nachteile. Gleich vorweg, der Punkt „groß“ ist relativ. Da es hier nur um den Hochtonbereich geht, sind auch die Dimensionen des Hornvorsatzes Hifi- und wohnraumkompatibel.
Worum geht’s beim Horn?
Hornlautsprecher zeichnen sich dadurch aus, dass sie extrem laut können. Das hängt damit zusammen, dass der Schall im „trichterförmigen“ Horn gebündelt und gerichtet abgestrahlt wird. Der entscheidende Faktor ist dabei, dass bei einem “normalen“ Chassis die Luft seitlich „ausweichen“ kann, es wird somit weniger Luft vor der Membran komprimiert, somit weniger Schall“druck“ erreicht. Das Horn verhindert das seitliche Ausweichen der Luft. Der Techniker spricht in dem Zusammenhang von einer akustischen (Impedanz-)Transformierung. Mit Ironie: Es ist ein „akustischer Trafo“. Zusätzlich wird der Schall von der Membran durch den „Hals“ des Horns über die sog. „Mundöffnung“ abgestrahlt. In der Theorie entspricht die Mundöffnung einer gleichgroßen Membran. Insgesamt wird die Membran also besser an die Luft angekoppelt – der Wirkungsgrad des Systems (Treiber und Hornvorsatz) steigt an.
Im Ergebnis sind wesentlich kleinere Membranbewegungen für den gleichen Pegel erforderlich als bei einem Chassis ohne Hornvorsatz.
Wie wir wissen, sind kleine Membranbewegungen vorteilhaft, da Verzerrungen durch Klirr und Intermodulationen niedrig bleiben. Kurz: Kleine Membranbewegungen erzeugen auch nur kleine Verfälschungen. Mit kleinsten Membranbewegungen werden in Kombination mit dem Hornvorsatz hohe Pegel möglich, die auch kaum Leistung einfordern. Somit können überragende Ergebnisse im Bereich der Dynamik mit sehr niedrigen Verzerrungen erreicht werden. Hier spielt das Horn seinen größten Trumpf aus.
Da der Mittel- und die Tieftöner nicht so laut können wie das Horn, wird das Horn in der Weiche „runtergeregelt“. In der Folge sind die Membranbewegungen sehr „sparsam“ und somit werden Verzerrungswerte erreicht, die um „die Nulllage pendeln“.
Das Horn hat eine gewisse Baulänge zwischen Mund- und der Halsöffnung, an der der Tweeter befestigt ist. Dadurch „rutscht“ das Hochton-Chassis weiter nach „hinten“ oder genauer nach „innen“. Das ist gut, denn somit befindet sich das akustische Zentrum des Tweeters ungefähr auf einer Ebene mit dem akustischen Zentrum des Mitteltöners. Das akustische Zentrum eines Chassis ist in etwa dort, wo die Schwingspule mit der Membran verklebt ist. Je enger diese Zentren mehrerer Chassis zusammenliegen, desto geringer sind die Laufzeitdifferenzen des Musiksignals auf dem Weg zum Ohr. Die umgangssprachliche Zeitrichtigkeit verbessert sich, was der Ortung und Abbildung zu Gute kommt.
Randnotiz: Genau das ist ja der große Vorteil des PIEGA Coax-Chassis. Dort liegen die akustischen Zentren des Mittel- und des Hochtöners nicht nur auf einer Ebene, sondern auf einem Punkt.
Der Hornvorsatz verbessert den Wirkungsgrad, das hatten wir schon. Aber da sich der Wirkungsgrad auch im unteren Frequenzbereich des Tweeters erhöht, kann er tiefer angekoppelt werden. Während der baugleiche Tweeter in der 701 so bei ~3,5 kHz angekoppelt wird, fängt er in der 801 bereits ab ~2,7 kHz an zu arbeiten. Große Teile des Präsenzbereiches werden somit von der leichten Folie übertragen.
Denn wie die Stammleute im PIEGA-Forum wissen, fangen LS-Chassis ab bestimmten Frequenzen an zu bündeln. Irgendwo um 3 kHz liegt die Grenze beim Mitteltöner. Eine „Auswirkung“ der Bündelung ist eine Abweichung im Amplitudengang, vor allem in der seitlichen Hauptachse. Da der Tweeter bereits ab ~2,7 kHz seine Arbeit aufnimmt, kommt der Mitteltöner nicht in die „Gefahrenzone“. Es entsteht ein nahtloser Übergang zwischen Mittel- und Hochtöner, wodurch sich ein sehr ausgewogenes und homogenes Klangbild „in der Breite“ ergibt.
Gibt’s denn keine Nachteile, abgesehen von der Baugröße?
Durchläuft der Schall eine wie auch immer gestaltete Schallführung, entstehen an den Begrenzungsflächen stehende Wellen. Durch Ungleichmäßigkeiten im Abstrahlverhalten der Membran (Bündelungsverhalten) und den Näherungswerten in der Berechnung des Horns kann es in Summe zu Abweichungen im Amplitudengang kommen. Da aber die Ursachen und Auswirkungen bekannt sind, lässt sich das insbesondere über die Horngeometrie kompensieren.
Die Richtwirkung könnte im HiFi-Bereich ebenfalls ein Thema werden. Hier kann aber auch absichtlich ein gezieltes Abstrahlen erreicht werden, um z. B. die Akustik-Einflüsse von Boden/Decke zu reduzieren. Je nach Hornkonzeption, Einsatzzweck und Hörumfeld kann das also einen Vor- oder Nachteil bedeuten. PIEGA setzt eine Horn-Geometrie ein, die eine sehr gleichmäßige Horizontalabstrahlung ermöglicht, was eine recht gleichmäßige Energieabgabe in den heimischen Hörraum ergibt. In der Folge ist der Amplitudengang auch außerhalb der Achse noch recht gleichmäßig.
Ganz klar, viele ältere und einfachere Hornkonstruktionen haben das Prinzip in Verruf gebracht. Das Wissen um Hornkonstruktionen ist allerdings ständig gewachsen und die Zeiten, dass Hörner verfärben (die berühmt-berüchtigte „Trötneigung“) sind lange vorbei. Auch, dass an den Hornrändern Resonanzen entstehen könnten, ist in der Ursache mittlerweile bekannt und kann in der Ausformung/Materialwahl berücksichtigt werden. Allerdings stecken die damals gravierenden Nachteile noch irgendwie in den Köpfen. Insgesamt gesehen sind ein paar Nachteile zwar immer noch vorhanden, aber bei weitem nicht mehr in den Größenordnungen, wie vor 50 oder 60 Jahren. Überwiegen also die Vorteile so stark, dass die Nachteile in Kauf genommen werden können?
Soweit die ganze Theorie.
Lassen wir den Tieftonbereich (größenbedingt) mal außen vor, könnte das Horn also ein durchaus probates Mittel auch für den Heim-HiFi-LS werden. Insofern war ich natürlich sehr gespannt, wie das Ganze funktioniert, zumal die Kombination Horn und Folientreiber im HiFi-Bereich eher selten ist.
Bevor gehört wurde, durfte ich Roger bei der Abstimmung über die Schulter sehen. Für dieses Feintuning wurde die „Messe-Version“ als Vergleich genommen, die einige von euch vielleicht auf der HighEnd in München (2025) hören konnten. Das Feintuning für die Serie erfolgte an einer „weichenlosen“ 801-Variante. Wie das im Prinzip genau abläuft, könnt ihr hier nachlesen.
Für meine Ohren war die Messe-Variante im Mittel-Hochtonbereich nicht ganz perfekt ausgewogen. Roger demonstrierte, wie sich die einzelnen Weichenparameter auswirken und sich dabei der Charakter des LS veränderte. In der endgültigen Abstimmung ergab sich eine perfekte Balance zwischen dem Mittel- und Hochtöner, gleichzeitig wurde der Bass optimiert. In dieser Abstimmung wird die Weiche für die Serie gebaut. Die nachfolgenden Vergleiche beziehen sich natürlich auf diese Variante.
Die meisten Hörvergleiche erfolgten im „vernünftigen HiFi-Pegel“ (irgendwo um 75 dB am Hörplatz bei ca. 3 Meter Abstand). Aber auch recht leise wurde gehört, und natürlich haben wir gelegentlich auch „den Bären steppen lassen“. Die Bandbreite der Musikauswahl bestand aus ruhigen Aufnahmen mit A Capella-Stimmenaufnahmen im kleinen Studio, über Rock-Konzert und Blueskeller bis zum Live-Auftritt eines Swing-Orchesters und ihren Bläser-Attacken.
Die Streaming-Musik spielte über Rogers Notebook, welches auch die Weiche für die 801 generierte. Das Signal ging vom Notebook über ein RME-Interface in die prof. Mehrkanal-Endstufe, die die 2 x 3 Wege der 801 antrieb. Streng genommen ist die gehörte 801 demnach ein Aktiv-LS, der aber in seiner Abstimmung 100%ig identisch mit der späteren Serienversion ist. Die prof. Mehrkanalendstufe befeuerte GLEICHZEITIG zusätzlich die 701 und die Coax 611. Somit gilt: ALLE Lautsprecher und jedes einzelne Chassis der 801 wurden über baugleiche Verstärker betrieben!
Wir hörten die Premium 701, die 801 und die 611 im direkten Vergleich ohne umstecken und mit identischem Pegel. Ganz klar, das ist ein Vergleich, den man in dieser Form beim Händler wahrscheinlich nicht durchführen kann.
Vielen Dank an Roger für seine Unterstützung


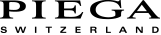
Kommentar